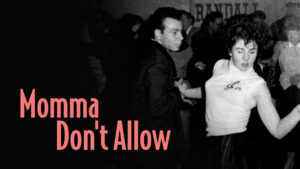Im Rahmen des 19. Darmstädter Jazzforums – „Universal Counsciousness“ und Teil der Filmreihe „Jazz is the Place“ wurde im Programmkino Rex in Darmstadt der britische Kurzfilm Momma Don’t Allow (1956) von Karel Reisz und Tony Richardson gezeigt. Hier spielt die Jazzmusik eine leitende Rolle – der Film gilt als ein Schlüsselmoment der Free Cinema-Bewegung. Viel Spaß beim Lesen!
Karel Reisz’ und Tony Richardson’s Momma Don’t Allow (ursprünglich „Jazz“) führt uns ins vibrierende Leben Londons der 1950er Jahre – genauer in den Wood Green Jazz Club, wo die Nacht dem traditionellen Jazz und der lebensfreudigen Arbeiterjugend gehört. Der Film gilt als ein Schlüsselwerk der britischen Free Cinema-Bewegung und ein Beispiel für die naturalistische Low-Budget-Ästhetik – gefilmt mit Handkameras und natürlichem Ton. Er setzt auf pure Authentizität und fasziniert mit „Einfachheit“. Handkameras fangen spontane Momente ein, der Ton bleibt roh, die Ästhetik ist ganz nah am Leben dran.
Schon der Auftakt hat fast ethnografische Qualität. Wir beobachten Menschen bei alltäglichen Beschäftigungen – ein Metzger schneidet Fleisch, ein Zahnarzt arbeitet mit seiner Patientin, Leute kommen zurück von der Arbeit, steigen ein und aus den Zügen – alles wirkt beiläufig. Doch der gewöhnliche Alltag kommt zu einem Ende und führt in den Jazz-Club, wie das eigentliche Geschehen beginnt.
Langsam verdichtet sich die Erzählung weiter: Die Figuren finden sich in einem Jazz-Club ein, wo eine Band spielt. Hier entfaltet der Film seine eigentliche Energie: Die Jazzmusik dient nicht nur der intellektuellen Betrachtung, sondern hat auch eine klare soziale Funktion – sie bringt die Menschen zum Tanzen, Flirten und Lachen. Es ist die Musik eines Abends, die Gemeinschaft stiftet. Richardson und Reisz tauchen in eine Gesellschaft ein, die sich nach der Arbeit nach Geselligkeit und Vergnügen sehnt.
Die Kamera bleibt zurückhaltend, distanziert und dennoch mittendrin – ohne Kommentar, aber gleichzeitig auch als Teil des Geschehens. Die wenigen Dialoge gehen in der Musik fast unter – der Jazz übernimmt die filmische Rahmenführung.
Das schafft einen leicht dokumentarischen Ton, der die Zuschauer*innen eher zum Betrachter als zum Mitfeiernden macht. Die Tanzszenen – der Rhythmus und die Begeisterung steigen immer mehr mit der Zeit – sind rhythmisch und immer abwechselnd geschnitten. Die Szenen wechseln zwischen dem was in dem Jazz Club geschieht und was draußen. Immer mehr Menschen verschiedener Gesellschaftsschichten kommen rein, kaufen Tickets, treffen Freunde und genießen auf einmal zusammen die fröhliche Tanz-Athmosphäre. Auf Dauer wirkt das aber eher etwas monoton. Immer wieder dieselben Paare, dieselben Bewegungen. Zwar vermittelt das den Eindruck von Authentizität, doch filmisch wirkt es stellenweise wie eine Endlosschleife.
Und doch: Momma Don’t Allow ist ein charmantes Zeitdokument, das Jazz als einen zentralen Ort der Gemeinschaft porträtiert. Der Film führt eher in seine soziale Praxis als in seine spirituelle Bedeutung ein. Es geht weniger um große Botschaften als um ein Lebensgefühl – ein gemeinsames Ausbrechen aus Routine, ein „Escape“-Ort aus dem Einerlei des Lebens, das von Arbeit und Hektik stark geprägt ist. Und genau das ist seine Stärke: der Blick auf das Alltägliche, die Freude an der Bewegung, das kollektive Erlebnis. Wenn der Film eine doch spirituelle Botschaft vermitteln sollte, dann diese der „heilenden“ Musik, die Musik für die Seele, die Musik, die das Leben etwas schöner und leichter macht. Die Jazzmusik erinnert an die Kraft der Sozialisierung und der Gemeinschaft. Wer sich von der mitreißenden Stimmung der 50er-Jahre und der lebendigen Kraft des Tanzes im Rhythmus traditioneller Jazzmusik verzaubern lassen möchte, findet in diesem Film das perfekte Erlebnis!
Hier kann man sich den Film selber anschauen!
Tsvetelina Topalova (m)